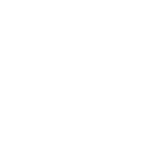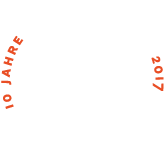Tatsächlich kennt auch die Medizin die "saisonal abhängige Depression" (Seasonal affective disorder (SAD)).
Auch wenn die Gründe für die herbstliche Verstimmung bisher noch nicht eindeutig geklärt werden konnten, so konnte bisher in Studien herausgefunden werden, dass ca. jeder Sechste von einem Herbstblues betroffen ist (Pirek et al., 2016). Der Herbstblues ist also keineswegs ein Mythos.
Es wird vermutet, dass die verminderte Sonneneinstrahlung ein möglicher Auslöser zu sein scheint. Ein Lichtmangel an den kürzer werdenden Herbsttagen kann dazu führen, dass das Schlafhormon Melatonin nicht nur nachts, sondern auch tagsüber vermehrt ausgeschüttet wird. Unsere innere Uhr, die dem Körper signalisiert, wann Tag und wann Nacht ist, muss sich durch die abnehmende Helligkeit umstellen. Sobald die Fotorezeptoren auf der Netzhaut im Auge Tageslicht registrieren, werden durch das Gehirn Befehle an die Zirbeldrüse geschickt, die in der Nacht das Schlafhormon Melatonin produziert. Durch den Befehl wird signalisiert, dass bei Tag kein Melatonin mehr ausgeschüttet werden soll. Im Herbst und Winter ist es aber noch dunkel, wenn wir schon wach sind. Die Zirbeldrüse produziert weiter Melatonin. Die Folge: Wir kommen morgens oft schlechter aus dem Bett, sind müde, uns fehlt Energie und Antrieb (Wehr et al., 2001).
Darüber hinaus kann bei reduzierter Sonneneinstrahlung ein Vitamin-D-Mangel entstehen, da der Körper das Vitamin nur bei genügend Sonneneinstrahlung selbst herstellen kann. Ein solcher Mangel kann eine bedrückte Stimmung weiter verstärken.
Auch der Botenstoffhaushalt des Gehirns könnte eine weitere mögliche Erklärung für die schlechte Stimmung in Herbst und Winter sein. Die Produktion des als Glückshormon bekannten Serotonins wird durch Sonnenlicht messbar angekurbelt – in der dunklen Jahreszeit wird davon deutlich weniger ausgeschüttet (Lambert et al., 2002). Wissenschaftlerinnen haben auch jahreszeitliche Schwankungen im Stoffwechsel der Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin entdeckt, die wichtig für Motivation und Antrieb sind bzw. Wachheit und Aufmerksamkeit steuern (Praschak-Rieder et al., 2012).
Konkrete Tipps gegen den Herbstblues
Jeden Herbst oder Winter nach Jamaika zu flüchten, ist sicher eine Möglichkeit. Aber auch in Deutschland ist man dem Stimmungstief keineswegs hilflos ausgeliefert.
Die folgenden Tipps und Maßnahmen helfen gegen Antriebslosigkeit und Müdigkeit im Herbst:
Die Lichtzufuhr erhöhen, um den möglicherweise ursächlichen Lichtmangel zu reduzieren. Eine erste Möglichkeit bietet sich durch ausgedehnte Spaziergänge in der Herbst- oder Wintersonne. Das macht wach und fördert die gute Laune.
Mit einer Tageslichtlampe, die ein fast unangenehm helles, sehr weißes Licht mit hohem Blauanteil abgibt, kann man künstlich nachhelfen. Eine halbe Stunde morgens vor der aufgestellten Tageslichtlampe, beim Frühstücken, Lesen oder am Laptop arbeiten, ist meist schon ausreichend, um die innere Uhr wieder ins Gleichgewicht zu bringen. (Lam et al., 2006).
Auch Sport und Bewegung können antidepressiv wirken, da durch die körperliche Aktivität der Serotoninspiegel im Körper steigt. Serotonin ist ein Hormon, das auch als Glückshormon bezeichnet wird. Es wirkt stimmungsaufhellend und antriebssteigernd. Es lohnt sich also, sich aufzuraffen, die gemütliche Couch und Kuscheldecke zu verlassen und die Sportschuhe anzuziehen.
Und manchmal kann es auch schon helfen, sich bewusst zu machen, warum die eigene Stimmung gerade so negativ ist. Zu überlegen, ob es Faktoren gibt, die diese negative Stimmung noch zusätzlich fördern. Und sich dann im Anschluss bewusst etwas Gutes tun, um für einen höheren Wohlfühlfaktor zu sorgen. Denn Selbstfürsorge und die eigene Wertschätzung tragen maßgeblich dazu bei, die eigene Psyche zu stärken.
Psychische Gesundheit und Stressmanagement
Studiengang M. A. Prävention und Gesundheitsmanagement
Der Erhalt, die Wiederherstellung und die Verbesserung von Gesundheit und insbesondere die Vorbeugung von chronischen Erkrankungen haben sich, u. a. bedingt durch veränderte Anforderungen in der Arbeitswelt und den demografischen Wandel, zu einigen der größten gesellschaftlichen Herausforderungen entwickelt.
Der Studiengang qualifiziert durch individuell wählbare Schwerpunkte, z. B. Psychische Gesundheit und Stressmanagement.
Mehr Infos: Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement
Quellen:
Lambert, G. W., Reid, C., Kaye, D. M., Jennings, G. L., & Esler, M. D. (2002). Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain. The Lancet, 360(9348), 1840-1842.
Lam, R. W., Levitt, A. J., Levitan, R. D., Enns, M. W., Morehouse, R., Michalak, E. E., & Tam, E. M. (2006). The Can-SAD study: a randomized controlled trial of the effectiveness of light therapy and fluoxetine in patients with winter seasonal affective disorder. American Journal of Psychiatry, 163(5), 805-812.
Praschak-Rieder, N., Willeit, M. (2011). Imaging of Seasonal Affective Disorder and Seasonality Effects on Serotonin and Dopamine Function in the Human Brain. In: Carter, C., Dalley, J. (eds) Brain Imaging in Behavioral Neuroscience. Current Topics in Behavioral Neurosciences, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/7854_2011_174
Pjrek, E., Baldinger-Melich, P., Spies, M., Papageorgiou, K., Kasper, S., & Winkler, D. (2016). Epidemiology and socioeconomic impact of seasonal affective disorder in Austria. European psychiatry, 32, 28-33.
Wehr TA, Duncan WC Jr, Sher L, Aeschbach D, Schwartz PJ, Turner EH, Postolache TT, Rosenthal NE. A circadian signal of change of season in patients with seasonal affective disorder. Arch Gen Psychiatry. 2001 Dec;58(12):1108-14. doi: 10.1001/archpsyc.58.12.1108. PMID: 11735838.