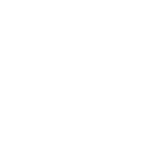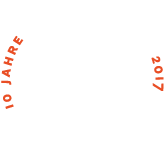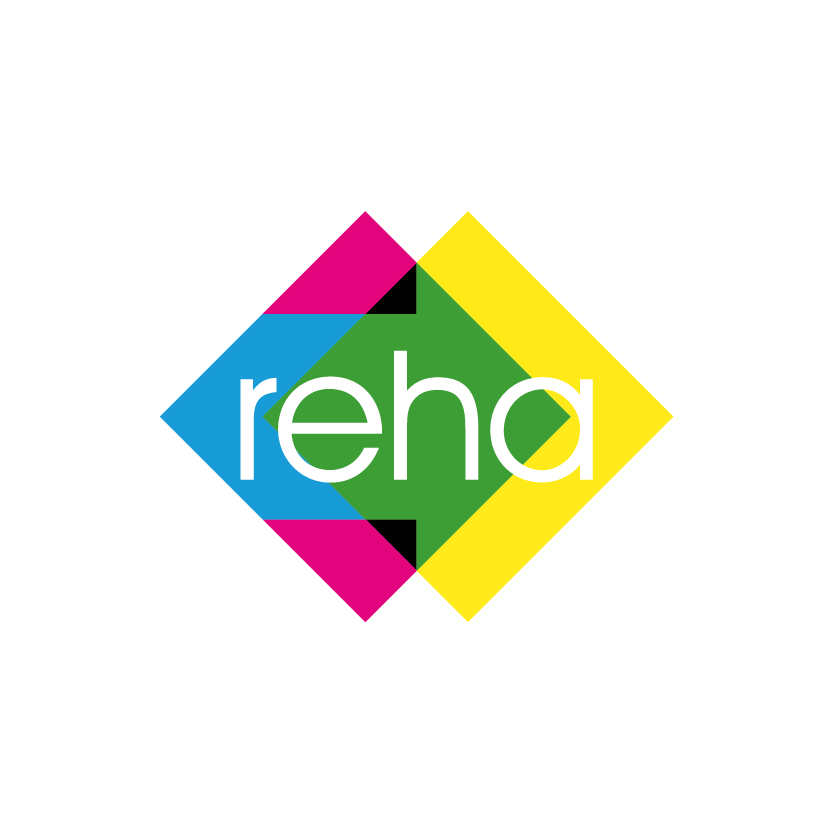Storytelling für Führung und Kommunikation
Was ist Storytelling?
Storytelling ist die Kunst, Geschichten zu erzählen – eine Methode, Informationen, Emotionen, Erfahrungen oder Werte in Form einer Erzählung zu vermitteln. Es bezeichnet den gezielten Einsatz von Geschichten, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen – etwa in im Marketing oder im Management. Das wird besonders im Zusammenhang mit der strategischen Vorgehensweise deutlich. Strategie ist immer eine Ziel-Weg-Definition. Eine Story ist der Weg des Helden zum Happy End mit der Überwindung eines Hindernisses. Darum ist eine Story der beste Weg eine Strategie zu erklären und der erste Schritt für eine erfolgreiche Umsetzung. Denn nur das, was verstanden wird, wird auch umgesetzt. Und nur das was verständlich kommuniziert wird, im Idealfall in Form einer Story, wird auch verstanden.
Bereits jetzt wird die Relevanz für Führungskräfte deutlich. Denn was bedeutet Führung? Im Kern geht es bei Führung darum, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und andere zu motivieren und zu unterstützen. Gute Führungskräfte zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, Visionen zu entwickeln, Kommunikation zu fördern, Konflikte zu lösen und eine positive, produktive Atmosphäre zu schaffen. Dabei dient jede Rede, jedes Gespräch oder ein Vortrag der Überzeugung. Gerade für Führungskräfte ist, dass das wichtigste Handwerkzeug. Diese Überzeugungskraft ist heute so entscheidend wie lange nicht mehr. Grund dafür die der schnelle Wandel unserer Gesellschaft. Menschen als auch Unternehmen beziehungsweise Organisationen haben die Notwendigkeit zum Wandel und Veränderung. Genau dafür braucht es Erklärung und Überzeugung.
Neue Art der emotionalen Kommunikation
Storytelling bietet hier einen wirkungsvollen Ansatz: Geschichten wecken Emotionen, bleiben im Gedächtnis und stärken die Verbindung zu Mitarbeitenden, Kunden und Stakeholdern. Warum? Jeder von uns wächst mit Geschichten auf. Daher sind Geschichten auch der Weg, wie wir uns erinnern. Nicht reine Fakten und Zahlen, sondern Storys bleiben uns im Gedächtnis. Sie können von Führungskräften auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Dazu zählen beispielsweise:
- Einsatz in Change-Prozessen
- Vermitteln von Vision und Strategie
- Förderung von Kultur und Werten
- Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit
Aktuell gibt es zwar eine wachsende Selbstbestimmung von Mitarbeitenden, aber trotzdem wird zur Entscheidungsfindung nach wie vor Führung benötigt. Vertrauen ist hier der Schlüssel. Richtig eingesetzt können Geschichten bei Mitarbeitenden sinn- und gemeinschaftsbildend eingesetzt werden. Nicht Organigramme und Arbeitsanweisungen geben die Richtung vor, sondern gemeinsame Werte und Leitlinien. Geschichten, die auf dem Flur und in der Kaffeeküche erzählt werden, belegen die wahren Werte einer Organisation. Diese Geschichten sollten nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst mitgestaltet und genutzt werden. Mitarbeitende werden sich auf diese Art und Weise selbst als Teil der Organisation sehen und die Geschichten erzeugen damit Bindung. Es wird eine Lagerfeuer Mentalität gebildet. Es wird deutlich, Kommunikation in Form von Geschichten sind ein Erfolgsfaktor. Es bedarf daher narrativer Kommunikation. Gefragt sind inspirierende Narrative: Geschichten, die Zusammenhänge aufzeigen, Emotionen wecken und Identifikation ermöglichen. Narrative sind althergebrachte Erzählungen, welche von Kultur zur Kultur weitergegeben werden. Beispiele dafür sind "Mensch vs. Maschine", "Angst und Faszination vor dem Unbekannten" oder "Die da oben, wir da unten".
Führung mit Methode: PSSS
Eine Methode, die zur Erstellung guter Geschichten genutzt werden kann, ist die PSSS-Methode. Das bedeutet:
- P wie passioniert: Es gilt Begeisterung zu entfachen. Die Zuhörer (hier Mitarbeitende) müssen mitgenommen werden. Daher sollten man die Erzählung zu seiner persönlichen Angelegenheit machen.
- S wie Story: Gute Geschichten zeigen das Leben, wie es wirklich ist. Es geht nicht um eine heile Welt, in der Erwartbares passiert, sondern es müssen Ecken und Kanten, Fehler, Probleme und Herausforderungen gezeigt werden. Das ist menschlich und nur so kann Identifikation erfolgen.
- S wie strukturiert: Man braucht eine chronologische Reihenfolge und Aufbau. Die klassische Geschichte benötigt: Anfang (Problem), Mitte (Höhepunkt) und Ende (Lösung). Dazu wird Held, Aufgabe, Wendepunkt und Schurke benötigt, um die klassische Heldenreise zu erzählen.
- S wie sinnlich: Informationen allein reichen nicht – die Geschichte muss zum Erlebnis werden und das mit allen Sinnen. Dafür braucht man Emotionen! Gerade diese haben wir im Kontext des Sports glücklicherweise zu Genüge.
An erster Stelle muss dabei immer das WARUM stehen. Dahinter stecken die Motivation und das Motiv, die einen selbst als Führungskraft oder die Organisation antreibt. Was ist die Essenz und die wichtige Botschaft, die man vermitteln möchte? Was steht für die Organisation, das Team oder auch Sie ganz persönlich auf dem Spiel? Dabei kann die Beantwortung dieser Frage unterschiedliche Bedeutung und Relevanz haben.
Die drei Ebenen der Relevanz
So gibt es die öffentliche Relevanz, die den Bezug zur Öffentlichkeit und Gesellschaft herstellt. Hier geht es vor allen Dingen um die Außendarstellung, also die externe Kommunikation. Welchen Beitrag leistet die Organisation zur Gesellschaft oder wie gestaltet sie diese aktiv mit? Das erfolgt in der Regel über externe Kommunikation, zum Beispiel online via Social Media. Dabei sind Geschichten als Content zu verstehen, die nach außen wirken und die zum Beispiel die Kultur und Werte der Organisation erlebbar machen sollen. Die nächste Ebene, die organisatorische Relevanz, funktioniert als Bedeutung für die Organisation selbst und die letzte Ebene, die individuelle Relevanz, spiegelt die Bedeutung für die Zielgruppe oder das Publikum wider.
Wie Geschichten mit Inhalt gefüllt werden
Aber wie füllt man die Geschichten nun konkret mit Inhalt? Ist das Warum geklärt und hat man sich für ein Narrativ entschieden, dann folgt das Erzählmuster. Hier geht es um die Ereignisebene und damit dem eigentlichen Plot oder dem Thema. Auch hierfür gibt es unterschiedliche Muster, wie zum Beispiel: "Die Heldenreise", "Vom Tellerwäscher zum Millionär" oder "Phönix aus der Asche". Jedes dieser Erzählmuster kennen Sie bereits aus Märchen, Geschichten oder auch Filmen. Betrachten Sie Ihre Organisation: Hier haben Sie bereits Helden, Inhalte und Schurken, um eine Heldenreise zu erzählen. Helden können Mitarbeitende oder Mitglieder sein, Inhalte Erfolge oder Schicksale, Schurken Gegner wie der innere Schweinehund oder auch Zweifel oder Angst.
Psychologie des Geschichtenerzählens
Dabei geht es aus psychologischer Sicht vor allem darum, das Unterbewusstsein zu erreichen. Das reine Wissen anhand von Zahlen, Daten und Fakten werden dem Wachbewusstsein zugeordnet. Aber um die Mitarbeitenden nachhaltig zu erreichen, reicht es nicht aus, nur an das Wachbewusstsein zu appellieren. Man muss das Unterbewusstsein erreichen, die Gegend, in der Geschichten, Bilder und im übertragenen Sinne unser Herz abgespeichert sind. Möchte man Informationen aus dem Wachbewusstsein zum Herzen bringen, ist viel Energie und Aufwand notwendig. Arbeitet man hingegen mit Geschichten, appelliert man direkt an das Herz und Unterbewusstsein. Es geht also darum Bilder im Kopf zu produzieren, so dass Informationen, die in Geschichten vermittelt werden, erlebt und erfahren werden. Richtig eingesetzt, kann Storytelling helfen, Visionen greifbar zu machen. Abschließend müssen folgende Tipps berücksichtigt werden:
Essenzielle Aspekte mit Storytelling in der Kommunikation:
- Jede Geschichte braucht einen Grund erzählt zu werden. Es braucht immer eine sinnstiftende Idee.
- Jede Geschichte braucht eine Hauptfigur. Diese muss klar identifizierbar sein, vor allen Dingen für die Zielgruppe.
- Jede Geschichte startet mit einem Konflikt und hat eine Transformation mit der Entwicklung zum Guten.
- Jede gute Geschichte erweckt Aufmerksamkeit. Emotionen und Empathie sind entscheidend.
- Jede gute Geschichte ist viral und wird damit weitererzählt.
Fazit
Führung bedeutet (eigene) Geschichten und Narrative zu nutzen, um seine Mitarbeitenden mitzunehmen. Dies gilt vor allen Dingen in schwierigen Zeiten. Dazu verbinden Geschichten und wecken ein WIR-Gefühl. Das erzeugt Bindung, Vertrauen und Zugehörigkeit. Mehr erfahren Sie beim diesjährigen Aufstiegskongress in Mannheim. Im Vortrag: „Leadership Storytelling – für Führungskräfte und alle, die etwas bewegen wollen“ gibt es tiefere Einblicke in die Thematik sowie Beispiele für die Umsetzung in der Praxis.
Jetzt Tickets sichern!